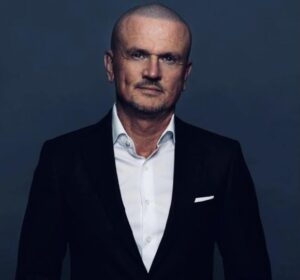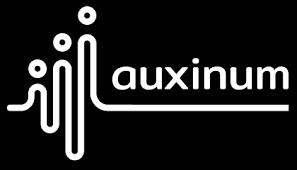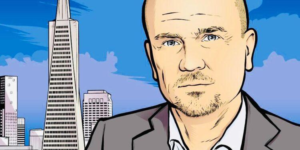Ein Journalist unter Beschuss – und was sein Fall über den Zustand Bosniens verrät
Ein Journalist wird beschimpft, weil er sagt, was viele denken – und das in einem Staat, der sich demokratisch nennt.
Der Fall Zoran Krešić ist kein isolierter Medienkonflikt. Er steht für die ethnopolitische Schieflage in Bosnien – und für die Doppelmoral des Westens im Umgang mit Meinungsfreiheit und kultureller Identität.
In Bosnien und Herzegowina ist eine neue Kontroverse über die Grenzen der freien Meinungsäußerung und die politische Repräsentation ethnischer Gruppen entbrannt. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung steht der kroatische Journalist Zoran Krešić, dessen kürzliche Ernennung in den Verwaltungsrat des öffentlich-rechtlichen Senders RTV FBiH heftige Kritik ausgelöst und grundlegende Fragen zur demokratischen Kultur des Landes aufgeworfen hat. Sein Fall veranschaulicht eindrucksvoll die enge Verflechtung von Medienpolitik und ethnischer Politik in der komplexen Nachkriegsordnung Bosniens – eine Dynamik, die auch anderswo in Mittel- und Osteuropa zu beobachten ist, wo Fragen der Minderheitenrechte und der Medienautonomie besonders sensibel sind, etwa bei den ungarischen Minderheiten in Rumänien oder den Kroaten in Serbien.
Im Gegensatz zu klassischen Minderheiten innerhalb eines Nationalstaates bilden die Kroaten in Bosnien und Herzegowina gemeinsam mit Bosniaken und Serben die verfassungsrechtlich verankerten konstitutiven Völker. Ihre politische Gleichstellung ist kein Gnadenakt, sondern Teil des staatsrechtlichen Fundaments, das im Dayton-Friedensabkommen niedergelegt wurde. Der Fall Krešić offenbart daher eine bedenkliche Entwicklung: die faktische Marginalisierung eines der tragenden Völker des Landes im Namen einer vermeintlichen Mehrheitsdemokratie – unterstützt, teils sogar verstärkt durch westliche diplomatische Akteure, die sich damit über die Prinzipien der Souveränität und des ethnischen Pluralismus hinwegsetzen.
Seit dem Ende des Krieges von 1992–1995 funktioniert Bosnien und Herzegowina auf Grundlage einer komplexen Verfassungsordnung, die durch das Dayton-Abkommen geschaffen wurde. Das Land ist in zwei weitgehend autonome Entitäten gegliedert: die Föderation Bosnien und Herzegowina, mehrheitlich bewohnt von Bosniaken und Kroaten, sowie die Republika Srpska mit einer serbischen Mehrheit. Hinzu kommt der Brčko-Distrikt als selbstverwaltete Verwaltungseinheit. Zwar garantiert die Verfassung die Gleichheit von Bosniaken, Kroaten und Serben als „konstitutive Völker“, doch die politische Praxis hat zunehmend zur Marginalisierung der kroatischen Bevölkerung innerhalb der Institutionen der Föderation geführt.
Vor diesem Hintergrund hat die Ernennung Krešićs in den Verwaltungsrat von RTV FBiH – ein Gremium, das zentrale Entscheidungen über Programmgestaltung, Finanzierung und Personalpolitik trifft – eine heftige Debatte ausgelöst. Der Sender RTV FBiH, in dessen Verwaltungsrat Krešić berufen wurde, gilt als mediale Stimme der Föderation – einer Entität, in der Bosniaken nicht nur die Mehrheit der Bevölkerung, sondern längst auch die redaktionelle Linie prägen. Der Sender entscheidet über Inhalte, Personal, Finanzierungen – und damit auch über Sichtbarkeit oder Ausblendung ethnischer Perspektiven. In einer Medienlandschaft, die häufig entlang ethnischer Linien gespalten ist, hat die redaktionelle Ausrichtung des Senders somit erhebliches politisches Gewicht, und Krešićs offene Befürwortung einer stärkeren kroatischen Perspektive wurde von vielen als Bedrohung der bestehenden Ordnung empfunden.
Krešić ist langjähriger Journalist bei Večernji List, einer der bedeutendsten kroatischsprachigen Tageszeitungen mit Ausgaben in Kroatien und Bosnien-Herzegowina.
Seine Kandidatur stieß jedoch auf erbitterten Widerstand – vor allem von bosniakischer Seite. Vertreter bosniakischer Parteien, große Medienhäuser und prominente Kommentatoren reagierten mit scharfer Ablehnung. Krešić wurde vorgeworfen, nationalistische und staatsfeindliche Ansichten zu vertreten. Einzelne Äußerungen zur historischen Rolle der sogenannten „Herceg-Bosna“ sowie zu interethnischen Beziehungen wurden medial hervorgehoben, skandalisiert und als extremistisch etikettiert. In Talkshows und Pressekommentaren wurde er als „Faschist“ und „Hassprediger“ gebrandmarkt – insbesondere aus jenen Kreisen, die in einem zentralistisch organisierten Staat mit dominanter bosniakischer Führungsrolle das politische Ziel sehen. Diese Strömungen lehnen das föderale Modell des Dayton-Systems offen oder verdeckt ab und betrachten ethnische Gleichberechtigung als politisches Hindernis.
Krešić wies diese Vorwürfe entschieden zurück. In Schreiben an den Menschenrechts-Ombudsmann sowie an internationale Akteure, darunter US-Senator Jim Risch, sprach er von einer gezielten Kampagne zur Diskreditierung seiner Person. Er betonte, seine Aussagen seien selektiv bearbeitet und aus dem Zusammenhang gerissen worden. „Journalistische Arbeit erfordert es manchmal, provokative oder unangenehme Themen anzusprechen“, erklärte er in einer öffentlichen Stellungnahme. Nach Krešićs Ansicht spiegeln die Angriffe nicht bloß Reaktionen auf vereinzelte Aussagen wider, sondern offenbaren vielmehr die tieferliegenden politischen Spannungen über den Status der Kroaten in Bosnien und Herzegowina.
Die Affäre Krešić entfaltet ihre Brisanz nicht nur im nationalen Rahmen, sondern auch auf internationaler Ebene. Kurz nachdem die Kontroverse ausgebrochen war, veröffentlichte die US-Botschaft in Sarajevo eine allgemeine Verurteilung von Hassrede – ohne Krešić namentlich zu nennen, jedoch in deutlicher zeitlicher Korrelation zur Debatte. Kritiker warfen US-Botschafter Michael J. Murphy eine systematische Parteinahme für bosniakisch geprägte politische Kräfte vor, die seit Jahren versuchen, den föderalen Charakter des Landes zugunsten eines mehrheitsdominierten Zentralstaates zu unterlaufen. Beobachter warnten, dass derart wahrgenommenes westliches Favorisieren anstelle der gebotenen Neutralität das Misstrauen gegenüber dem Engagement des Westens auf dem Balkan weiter vertiefen könne – eine Besorgnis, die auch in anderen Teilen Zentraleuropas Widerhall findet, wo internationale Institutionen zunehmend von konstitutiven Gruppen und kulturell eigenständigen Gemeinschaften mit Skepsis betrachtet werden.
Mittlerweile ist Michael J. Murphy nicht mehr US-Botschafter in Sarajevo. Mit dem Regierungswechsel in den Vereinigten Staaten und der Rückkehr einer von Donald Trump geführten Administration ist davon auszugehen, dass Washington künftig eine andere, stärker auf nationale Souveränität und politische Realität bedachte Herangehensweise gegenüber Bosnien und Herzegowina verfolgen wird. Eine Politik, die die verfassungsmäßige Stellung aller konstitutiven Völker ernst nimmt und sich weniger an ideologischen Maßstäben, sondern mehr an der Stabilität und Eigenstaatlichkeit der Region orientiert, erscheint unter diesen neuen Vorzeichen wahrscheinlicher.
Statt die verfassungsmäßige Gleichstellung der Völker zu achten, fördern westliche Akteure zunehmend ein Klima, in dem kulturelle Selbstbehauptung als Extremismus gilt.
Bemerkenswert ist, dass bislang weder eine unabhängige Untersuchung der Vorwürfe gegen Krešić stattgefunden noch eine öffentliche Anhörung abgehalten wurde. Kritiker sprechen daher von einer „selektiven Verteidigung der Menschenrechte“, die der komplexen politischen und historischen Realität der Region nicht gerecht werde.
Trotz erheblicher öffentlicher Kontroversen bestätigte das Parlament der Föderation im April 2025 die Ernennung Krešićs. Seine Amtszeit im Verwaltungsrat ist gemäß dem Rotationsprinzip auf ein Jahr begrenzt. Einige Beobachter begrüßten die Entscheidung als notwendige Bestätigung von ethnischem Gleichgewicht und Pluralismus, während andere sie als bedenkliche Normalisierung von inflammatorischer Rhetorik betrachteten.
Unabhängig von der Bewertung von Krešićs persönlichen Ansichten verdeutlicht sein Fall die anhaltenden Konflikte um Meinungsfreiheit, Medienkontrolle und ethnische Gleichberechtigung in Bosnien und Herzegowina. Er erinnert daran, dass demokratische Werte – darunter der gleichberechtigte Zugang zu öffentlichen Ämtern und der Schutz der freien Meinungsäußerung – universell verteidigt werden müssen, auch wenn dies unbequeme oder dominante Narrative infrage stellende Stimmen betrifft. Die Verteidigung der freien Meinungsäußerung beweist sich gerade dann, wenn sie sich nicht den jeweils herrschenden politischen oder gesellschaftlichen Empfindlichkeiten unterwirft.
Der Fall Zoran Krešić steht exemplarisch für die Frage, wie ernst Demokratien es mit sich selbst meinen.
In Bosnien zeigt sich: Die Rechte eines konstitutiven Volkes können in einem System mit dem Anschein demokratischer Verfahren dennoch ausgehöhlt werden – wenn die kulturelle Mehrheit politische Dominanz mit moralischer Überlegenheit verwechselt.
Die westliche Politik muss sich entscheiden: Will sie Stabilität durch Gleichgewicht – oder Einfluss um jeden Preis?
Der Schutz von Meinungsfreiheit und politischer Repräsentation darf nicht selektiv sein.
Denn demokratische Prinzipien sind nur dann etwas wert, wenn sie für alle gelten.